Klinik für Palliativmedizin: Aktuelle Studien zu Spiritual Care, Therapieverzicht und Soziale Arbeit
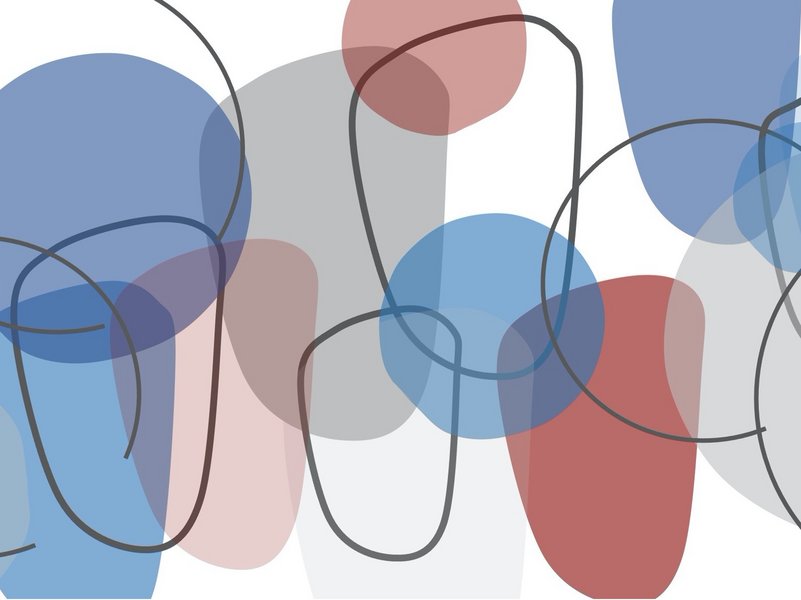
Forschende der Klinik für Palliativmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD) und am NCT Heidelberg haben kürzlich vier Publikationen veröffentlicht, die sich mit Spiritual Care in der Onkologie, der Frage nach dem Mindest-Allgemeinzustand bei onkologischer Systemtherapie und der Rolle von Sozialer Arbeit in der Palliativsituation befasst.
Spiritual Care liefert wichtige Unterstützung
Zwei aktuelle Publikationen aus der Klinik für Palliativmedizin behandeln das Thema Spiritual Care in der Onkologie. Spirituelle Betreuung bietet Unterstützung bei existenziellen Fragen und trägt dazu bei, den Patient:innen in einer schwierigen Zeit mehr Lebensqualität zu bieten. Da religiöse Traditionen von immer weniger Menschen praktiziert werden, könnte es sinnvoll sein, neue Rituale für die Sterbephase zu entwickeln und damit einen wertvollen Beitrag zur Betreuung von Sterbenden, ihren Angehörigen und dem professionellen Team zu leisten.
Links zu den Publikationen: doi: 10.21037/apm-24-119, doi: 10.1007/s00761-024-01631-x
Wann ist eine Chemotherapie nicht mehr sinnvoll?
Bei schwerkranken Krebspatient:innen stellt sich oft die Frage, ob eine Chemotherapie noch zumutbar ist. Kriterien, die helfen können, diese Nicht-mehr-Zumutbarkeit zu definieren, werden in einer neue Publikation zusammen gefasst. Dazu gehören ein schlechter Allgemeinzustand, das Ausbleiben einer Wirkung früherer Therapien, starke Nebenwirkungen. Gerade in Grenzsituationen spielt der ausdrückliche Wunsch der Patient:innen eine relevante Rolle. Gemäß internationalen Leitlinien sollte in den letzten Lebenswochen die Lebensqualität bestmöglich erhalten bleiben.
Link zur Publikation: Thiesbonenkamp-Maag J, Alt-Epping B. Zu krank für Chemo? – Kriterien für den Verzicht auf systemische Tumortherapie. Jatros Hämatologie & Onkologie 2025, 1: 64-65
Soziale Arbeit als unverzichtbares Element der Palliativversorgung
Sozialarbeiter:innen spielen eine wichtige Rolle in der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV), sind aber bislang nicht fest in die Strukturen eingebunden. Eine aktuelle Studie zeigt, dass Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte deren Arbeit schätzen – insbesondere bei organisatorischen und psychosozialen Fragen. Dennoch gibt es Hindernisse wie knappe Ressourcen und unklare Zuständigkeiten. Die Forschung unterstreicht, dass eine stärkere Integration von Sozialarbeiter:innen die Versorgung verbessern könnte, indem Patient:innen und Angehörige besser unterstützt und medizinisches Personal entlastet wird.
Link zur Publikation: doi:10.1177/26323524241310457







